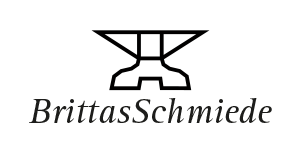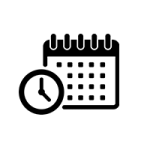Was tun, wenn man im Museum vor Brotlaibidolen steht und plötzlich eine Idee hat, die sich nicht mehr abschütteln lässt?
Ich war im Archäologischen Museum Frankfurt und habe mir die Ausstellung Aenigma 2.0 im rahmen einer Führung angesehen. Gezeigt wurden sogenannte Brotlaibidole – kleine, rätselhafte Tonobjekte aus der Jungsteinzeit. Die Frage, die sich in der Ausstellung gestellt wurde: Wofür waren diese Gegenstände gedacht?
Als ich die Brotlaibidole sah, hatte ich sofort eine Assoziation: In meinen Augen sind diese Idole Formen von Goldschmieden, um damit Ringe herzustellen. Die Form, die Größe, die eingedrückten Muster – alles schien zu passen.

Aber – ich war ja Besucherin einer Führung und dachte, ich höre mir an, was der Fachmann vom Museum dazu sagt. Ich wollte zu hören. Hat nicht geklappt. Als der wissenschaftliche Mitarbeiter sagt, es sei ein Rätsel, konnte mir nicht verkneifen zu fragen, ob da mal ein Goldschmied drauf geschaut hat? – oh, ich wiederhole mich. Von diesem Besuch (und seinen Folgen) habe ich ja schon berichtet. Nur kurz: Ich wurde zu einem Symposium mit den WissenschaftlerInnenn aus dem Bereich Brotlaibidole eingeladen – sogar der italienische Botschafter war da.
Meine Theorie wurde interessiert angehört, aber ich wollte wissen: Würde das wirklich in der Praxis funktionieren?
Repliken, Malvensamen und Fimo
Das Museum war offen für meine Anfrage und stellte mir Repliken zur Verfügung. Diese waren bemalt – sehr schön, aber für meine Zwecke ungeeignet. Ich wollte mit Wachs arbeiten, eventuell mit einem Trennmittel, das hätte die Farbe beschädigen können. Also habe ich eigene Formen mit Fimo nachgebildet.
Zentral für die Muster auf den Brotlaibidolen sind Malvensamen. Diese wurden in den weichen Ton gedrückt und erzeugen das charakteristische Muster. Ich hatte Glück: Der heiße Sommer hatte die Malven früh reifen lassen, und in einem städtischen Blumenkübel fand ich eine Pflanze mit gereiften Samen.


Wichtig: Sind die Samen zu reif und trocken, zerfallen sie – das bestätigte mein Versuch, genauso wie es auch in dem Vortrag der WissenschaftlerInnen beschrieben worden war, die sich mit den Idolen beschäftigen.

Ich habe die Samen in das Fimo gedrückt und mich an den Rillen ausprobiert: man kann sie mit Zweigen, einer Schnur oder mit einem dünnen Stäbchen formen.
Ausser den Malvensamen habe ich noch weitere Formen nachgebildet, wie ich sie von der Ausstellung kannte.
Das Fimo kam in den Ofen – und die Formen waren 30 Minuten später bereit.
Bienenwachs und Kohle
Der nächste Schritt war die Herstellung des Wachses. Bienenwachs allein ist zu weich. Es würde, wenn man es in Sand abformt, zu leicht verdrückt werden. Also habe ich Kohle genommen und auf einem Stein zu feinem Mehl gerieben. Wie viel Wachs und wie viel Kohle? Ich habe einfach ausprobiert. Das Wachs wurde schwarz und pastös. Überraschend formbar, überraschend haltbar.


Es braucht überhaupt kein Trennmittel, wenn man diese Mischung in Fimoformen schmiert. Wie das bei Ton ist, kann ich nicht sagen – aber mit Fimo hat es wunderbar funktioniert.

Man muss schnell sein und das warme Wachs in die Form schmieren und sehr zügig wieder herausdrehen. Das braucht etwas Übung – und der Wachs ist warm. Aber man dreht tatsächlich Ringe aus den Brotlaibidolen heraus.
Mein Mann hat Fotos gemacht, ich habe mir die Finger verbrannt.
Die ersten Versuche waren vielversprechend. Ich habe viele Wachs-Ringe hergestellt – die Brotlaibidole sind eine tolle Möglichkeit der Serienproduktion. Dann habe ich die entstandenen Wachsringe bearbeitet und jeden Ring etwas anders mit dem Messerchen geschnitzt. So blieben die Ringe massiver oder wurden eben filigraner. Das Wachs lässt sich gut modellieren.





Vom Wachs zum Metall
Ich habe die Wachsringe in meine Gießerei geschickt – und silberne Ringe zurückbekommen. Das Sandgussverfahren ist mir bekannt, aber ich habe es nicht selbst durchgeführt. Die Ausstellung in Frankfurt zeigt auch Siebe, mit denen feiner Sand gewonnen wurde – ein Hinweis darauf, dass Sandguss gemacht wurde. Ich möchte kurz skizzieren, wie ich mir vorstelle, dass Goldschmiede in der Bronzezeit vorgegangen sein könnten.
Zum Gießen benötigt man sehr feinen Sand. In der Ausstellung Aenigma 2.0 wurden Siebe gezeigt, mit denen solcher Sand gewonnen werden konnte. Zunächst wird eine Lage aus einem matschigen Tongemisch vorbereitet, darauf kommt der gesiebte Feinsand. Die Wachsringe werden mit einem Angusskanal versehen und aufgelegt, sodass später eine Verbindung zur Außenseite besteht. Anschließend wird alles mit weiterem Sand bedeckt und mit Ton oder Lehm verschlossen, damit nichts herausrieselt.
Beim Brennen schmilzt das Wachs aus, die Form bleibt stabil und bildet innen die Hohlräume der Ringe. In diese Gussform kann nun flüssige Bronze, Silber oder Gold eingefüllt werden. Nach dem Erkalten wird die Form zerschlagen, der Sand rieselt heraus – und zurück bleiben mehrere metallene Ringe. Eine Form der Serienproduktion.
Wie gesagt, den Teil hat eine Gießerei für mich erledigt, mit wesentlich moderneren Methoden. Ich habe die Ringe dann gefeilt, geschmirgelt und versäubert. Ob das in früherer Zeit genauso gemacht wurde, weiß ich nicht – ich halte es für möglich. Die gegossenen Ringe lassen sich weiterbearbeiten, feilen, schmieden.
Fazit: Eine mögliche Antwort auf das Rätsel

Ich hatte viel Freude an diesem Projekt – und war überrascht, wie gut es funktioniert hat. Ich hatte mit Fehlversuchen gerechnet, aber es hat alles funktioniert, die Ergebnisse sind – finde ich – richtig gut.
Brotlaibidole sind in meinen Augen Formen, um Schmuck – vor allem Ringe – herzustellen.
Jetzt bleibt noch die Frage, was das alles mit Batman zu tun hat:
Mein Sohn hatte mit etwa sechs Jahren eine Phase, in der Batman heiß geliebt wurde. Im Schwimmbad gab es eine Rallye mit gelben Badeenten: Die schnellste Ente gewann einen Preis, parallel dazu wurde zur Gestaltung der schönsten Ente aufgerufen. Natürlich wollten wir eine Batman-Ente basteln.
Ich fragte mich, wie sich ein schwarzer Umhang am besten modellieren ließe – und kam auf die Idee, Kohle in Bienenwachs zu reiben. Das hatte ich zuvor nie gemacht, war aber überrascht, wie gut sich daraus ein stabiler Umhang formen ließ. Eigentlich sollte Lukas das übernehmen, aber der Wachs war zu heiß zum Verarbeiten – das war der einzige Nachteil dieses Werkstoffs.
Das ausgehärtete Wachs war erstaunlich stabil und hätte sogar die Fahrt auf dem Wasser überstanden. Die Ente ging jedoch in den Dekorationswettbewerb – leider ohne Preis. Meine Schwester liebt Quietscheenten, und tatsächlich hat die Batman-Ente die Reise nach Australien überlebt. Jetzt treibt sie in Sydney mit meiner Schwester Unsinn – die gelbe Quietscheente mit dem knackschwarzen Umhang und Käppi.
Vielleicht ist das die Lösung des Rätsels von Aenigma 2.0. Vielleicht ist es nur ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin. Aber es ist ein Schritt, der zeigt: Experimentelle Archäologie kann Antworten geben – und manchmal kommt die Inspiration aus dem Kinderzimmer.